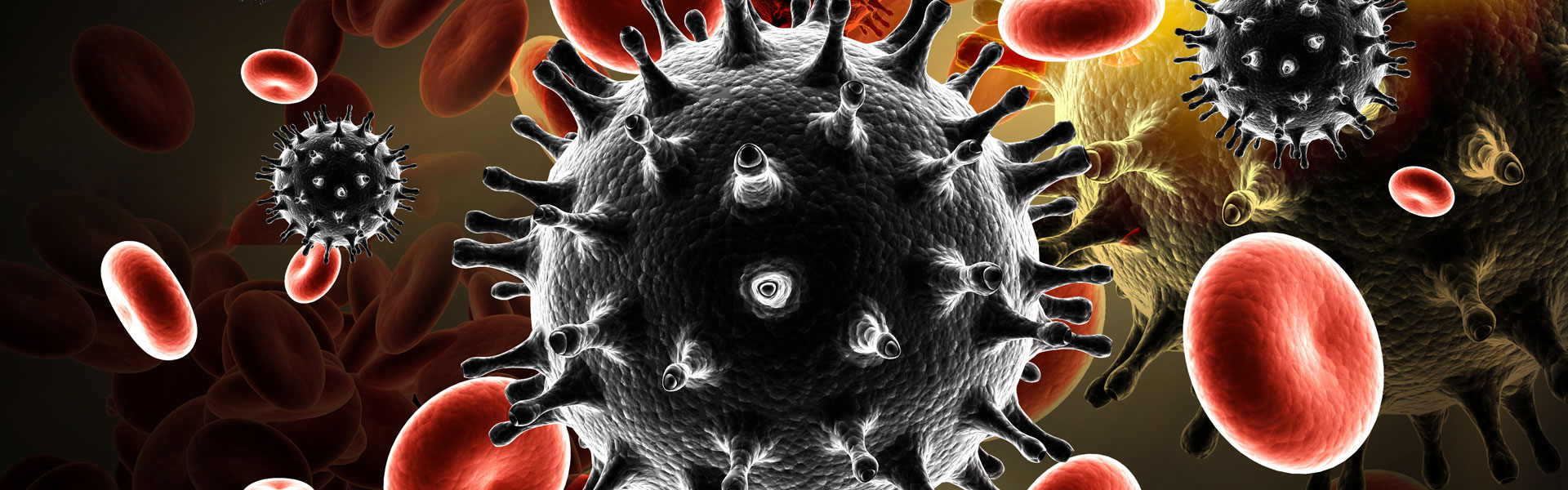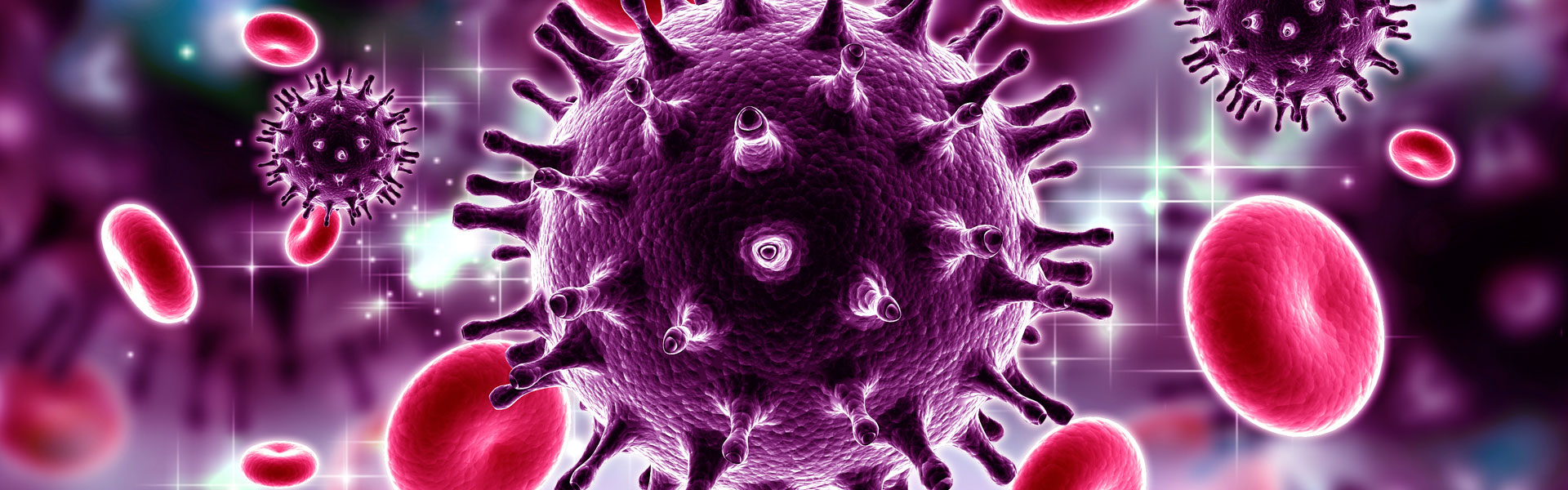„Die bedeutendste lebensmittelassoziierte Zoonose beim Menschen“
Im Alltag oft unterschätzt: eine Infektion mit Campylobacter-Bakterien. Prof. Dr. med. vet. Thomas Alter (linkes Foto) vom Institut für Lebensmittelsicherheit und –hygiene der Freien Universität Berlin und Prof. Dr. rer. nat. Stefan Bereswill (rechtes Foto) vom Institut für Mikrobiologie und Hygiene der Charité Berlin geben Auskunft über das Vorkommen, die Übertragung und den aktuellen Stand der Forschung von PAC-Campy – die Nachwuchsgruppe, die sie innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten koordinieren.
Weshalb ist das Bakterium der häufigste Krankheitserreger bei Lebensmitteln?
Thomas Alter: Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen industrialisierten Ländern ist die Campylobacter-Infektion laut Daten der Meldebehörden aktuell die zahlenmäßig bedeutendste lebensmittelassoziierte Zoonose beim Menschen. Wir befinden uns mit Inzidenzen um 90 pro 100.000 Einwohner über dem europäischen Mittel von ca. 40-50. Die Ursachen für diese hohen Inzidenzen und Prävalenzen sind vielfältig. Am Beispiel der Geflügelfleischkette, dem bedeutendsten der möglichen Übertragungswege, möchten wir dies kurz erläutern: Pathogene Bakterien der Gattung Campylobacter vor allem Campylobacter jejuni kommen fast ubiquitär in der Umwelt vor und gelangen über verschiedenste Wege in Geflügelbestände, wo sie sich rasch in diesen Tierbeständen ausbreiten. Klinische Symptome finden sich bei Geflügel fast nicht. Dadurch kommen Tier mit hohen Zahlen an Campylobacter im Darm in den Schlachthof. Zwar kann durch hohe Hygiene und technologische Optimierungen des Schlachtprozesses eine Kontamination des Geflügelfleischs mit Campylobacter minimiert werden, jedoch ist die Kontamination der Geflügelkarkassen nicht vollständig auszuschließen. Dadurch sind etwa 20-30% des Geflügelfleischs im Einzelhandel mit lebenden Campylobacter-Bakterien kontaminiert. Durch ausreichende Erhitzung können Campylobacter-Bakterien problemlos abgetötet werden, aber vor allem Mängel bei der Küchenhygiene führen zu Darminfektionen, die mit dem Symptomkomplex der Durchfallerkrankung mit krampfartigen abdominalen Schmerzen, Erbrechen und systemischer Beteiligung mit schlechtem Allgemeinzustand als Campylobacteriose bezeichnet wird. Da wir keine prophylaktische Intervention, wie z. B. einen gut wirksamen Impfstoff zur Verfügung haben, müssen wir an verschiedenen Stellen gleichzeitig und entlang der gesamten Lebensmittelkette arbeiten, um diese Infektion erfolgreich zu bekämpfen: angefangen bei Biosicherheitsmaßnahmen in den Tierbeständen, über Optimierung des Schlachtprozesses bis hin zur Verbraucheraufklärung.
Welche neuen Impulse setzt der Verbund PAC-Campylobacter bei der Erforschung des Erregers?
Stefan Bereswill: Die hohe Zahl der gemeldeten Fälle der Campylobacteriosen beim Menschen verdeutlicht die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Strategien zur Prävention, Kontrolle und Therapie von Campylobacter-Infektionen. Deshalb arbeiten wir im Verbund PAC-Campylobacter des „Nationalen Forschungsnetzes für zoonotische Infektionskrankheiten“ an verschiedenen neuen Interventionen, die alle zur Verminderung der Infektionszahlen beitragen sollen: Der erste Forschungsschwerpunkt untersucht die Effizienz und die praktische Implementierung von Interventionsstrategien entlang der Lebensmittelkette bei Geflügelprodukten. Weiterhin werden Infektionsmodelle in der Maus und in vitro-Assays ergänzend verwendet, um innovative therapeutische Ansätze zur Bekämpfung von Infektionen beim Menschen auf der präklinischen Ebene zu entwickeln. Um den öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Aufklärung von Ausbrüchen der Campylobacteriose zu unterstützen, werden auch molekulare Charakterisierungsmethoden für die Population des Krankheitserregers verbessert. Abschließend widmen sich mehrere Forschungsgruppen interdisziplinär der Verbesserung des Verständnisses der Mechanismen, die das Überleben außerhalb des Wirtes und die Übertragung von Campylobacter-Bakterien ermöglichen.
Die intensive Kooperation aller Partner im Konsortium hat die Senkung der Belastung von Geflügelfleisch mit Campylobacter-Bakterien und die daraus resultierende Senkung der Inzidenz von Infektionen beim Menschen zum Ziel.
Gibt es bestimmte Bereiche in der Lebensmittelproduktion, die besonders gefährdet sind für eine Verbreitung der Campylobacter-Bakterien?
Thomas Alter: Für die Erkrankungen beim Menschen spielt das Geflügel als Hauptreservoir für Campylobacter jejuni die größte Rolle. Ein hoher Prozentsatz unserer Geflügelbestände ist mit diesem Krankheitserreger kolonisiert, die Tiere zeigen jedoch nur in den seltensten Fällen Symptome.
Für den Transfer der Campylobacteriose als klassischer Zoonose zum Menschen sind aber auch Rinder, kleine Wiederkäuer und in geringerem Umfang Schweine von Bedeutung, die ebenfalls im Laufe der Mast oder der Milchproduktion keine oder nur schwach ausgeprägte Symptome zeigen.
Warum ist überdurchschnittlich Geflügel betroffen, wenn es um das Vorkommen des Erregers geht? Welche Besonderheit gibt es bei der Geflügelschlachtung?
Thomas Alter: Tatsächlich spielen technologische und physiologische Faktoren bei der Schlachtung der verschiedenen Tierarten eine Rolle für den Grad der Kontamination von Fleisch und dem Überleben dieser Bakterien im Schlachtprozesses.
Um ein Beispiel zu geben: Trotz der hohen Prävalenzen in den Schweinebeständen ist das vom Schweinefleisch ausgehende Risiko einer Campylobacter-Infektion eher gering. Im Gegensatz zum Geflügel, wo das Aufquellen der Haut während der Schlachtung und Verarbeitung ein Überleben von Campylobacter ermöglicht, wird durch die rasche Abtrocknung der Schweinehaut eine massive Abtötung der pathogenen Bakterien auf den Schweinekarkassen bewirkt. Die vergleichsweise glatte Oberfläche der Schweinehaut und die gute Austrocknung verhindern offensichtlich solche Überlebensraten während des Schlacht- und Kühlprozesses auf den Schweineschlachtkörpern.
Im Unterschied dazu haben die Campylobacter-Bakterien bei Geflügel in Federfollikeln und den Poren der Geflügelhaut in einer Tiefe von 20 bis 30 µm ein gutes Mikroklima zum Überleben, mit geringem Sauerstoffkontakt und einem Schutz vor Austrocknung.
Bedingt die Massentierhaltung die Ausbreitung des Bakteriums?
Thomas Alter: Sicher führt eine hohe Tierdichte zu einer rascheren Übertragung in einem Bestand. Andererseits zeigen europäische Studien, dass auch Geflügelhaltungen mit Auslauf und damit verstärktem Umweltkontakt hohe Campylobacter-Prävalenzen aufweisen. Hier spielen sehr wahrscheinlich verstärkte Kontakte zu anderen Vektoren wie Wildvögel und Insekten eine große Rolle.
Ist eine Nutztierhaltung, ohne dass das Bakterium im Bestand vorkommt, überhaupt möglich?
Thomas Alter: Eine vollständige Eliminierung der Campylobacter-Kontamination aus den Lebensmittelproduktionsketten ist derzeit nicht möglich. So können die Campylobacter-Bakterien aus dem ubiquitären Umweltreservoir über eine Vielzahl von Übertragungswegen in die Tierbestände für die Produktion von Fleisch und z. B. Eiern eingetragen werden. Aus der anderen Seite haben wir derzeit kein „silver bullet“, also z. B. einen Impfstoff zur Verfügung, der Tiere vor Kolonisation oder Infektion durch die Krankheitserreger schützt. Ziel ist es daher, hygienische, mikrobiologische und technische Bekämpfungsmaßnahmen zur Minimierung des Vorkommens von Campylobacter in den Beständen zu kombinieren und die quantitative Belastung von Tieren und Lebensmitteln mit Campylobacter zu senken.
Wie genau sehen die Übertragungswege bei der Verbreitung der Campylobacter-Bakterien aus?
Thomas Alter: Hier haben wir seit einigen Jahren recht konkrete Vorstellungen, die belegen, dass der Geflügelkette die größte Bedeutung zukommt. Je nach Studie beläuft sich dies auf etwa 30-50%. Über den Konsum von Rohmilch und nicht durchgegartem Fleisch sind aber auch Rinder, kleine Wiederkäuer und Schweine Ausgangspunkt für eine Campylobacteriose beim Menschen. Die bedeutendsten Risikofaktoren sind der Verzehr von unzureichend erhitztem Geflügelfleisch und Mängel in der Küchenhygiene. Weiterhin stellen das Baden in Oberflächengewässern, das mit Kot von Wildvögeln kontaminiert ist, und Tätigkeiten in Kläranlagen oder in der Sanierung von Abwassersystemen Infektionsrisiken dar. Auch kleine Kinder können sich durch das Spielen auf sandigen Spielplätzen infizieren, wie inzwischen mehrere Studien belegen. Auch hier sind u.a. Wildvögel und Nagetiere die Ursache der bakteriellen Kontamination.
Gibt es eine Erklärung, weshalb die Campylobacter-Fallzahlen zunehmen?
Stefan Bereswill: Seit Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes im Jahre 2001 sind Nachweise von darmpathogenen Campylobacter-Bakterien vor allem die Art C. jejuni beim Menschen und Hinweise auf eine akute Infektion, bundesweit meldepflichtig geworden. Diese Maßnahme zeigte dann auch sehr schnell einen hohen Anstieg der gemeldeten Fälle an. Die drastische Erhöhung der gemeldeten Campylobacteriosen in den Folgejahren kann auch durch Verbesserungen in der Diagnostik begründet sein. Die aktuellen Zahlen zeigen aber an, dass es sich um ein signifikantes infektionsbiologisches Problem handelt, das auch große sozioökonomische Relevanz hat. Die Kosten für lebensmittelbedingte Campylobacteriosen für die öffentlichen Gesundheitssysteme sowie für den Verlust der individuellen Gesundheit und Produktivität in der EU werden auf rund 2,4 Mrd. EUR pro Jahr geschätzt.
Inwiefern sind Gesundheitsämter bei der Bekämpfung bzw. Eindämmung der Ausbreitung hilfreich?
Stefan Bereswill: Die Gesundheitsämter sind über die im Infektionsschutzgesetz verankerten Meldepflichten für die Campylobacteriose direkt in den Infektionsschutz eingebunden. Diese wichtigen lokalen und überregionalen Behörden spielen auch in der Ausbruchsaufklärung und in der Unterbrechung der Infektionsketten eine bedeutende Rolle. Auch Rohmilch-assoziierte Ausbrüche der Campylobacteriose sind seit mehreren Jahren von zunehmend großer Bedeutung.
Wie lassen sich Campylobacter-Bakterien nachhaltig bekämpfen?
Thomas Alter: Wie bereits ausgeführt empfehlen die meisten Forschungsgruppen, die mit diesem Thema befasst sind, einen quantitativen reduktiven Ansatz. Das heißt, dass die Zahl von Campylobacter-Bakterien im Tier, am Schlachthof und im Lebensmittel quantitativ gesenkt werden soll. Das kann durch eine Kombination aus mehreren Interventionen auf verschiedenen Stufen der Lebensmittelkette – vor allem im Bereich der Geflügelhaltung erreicht werden. So zielen neue Interventionsmaßnahmen im Primärproduktionsbereich darauf ab, den Eintrag von Campylobacter-Bakterien in die Tierbestände zu verhindern und die quantitative Belastung zu senken. Dies soll z. B. durch Optimierung der Haltungsbedingungen, durch Kontrolle der Futter- und Wasserzusätze oder durch Bakteriophagenapplikation erreicht werden. Am Schlachthof kann dann weiterhin durch technologische Verfahren die fäkale Kontamination von Fleisch mit Campylobacter reduziert werden. Diese Maßnahmen müssen durch Informationen von Produzenten und Verbrauchern begleitet werden. Für die Verbraucher spielt in der Infektionsvermeidung eine gute Küchenhygiene und die Hygiene bei der Verarbeitung von Lebensmitteln eine besondere Rolle.
Ist die aufgenommene Menge an Bakterien für eine Erkrankung entscheidend?
Stefan Bereswill: Im Verhältnis zu anderen lebensmittelassoziierten Bakterien ist die Infektionsdosis sehr niedrig: Eine infektiöse Dosis von einigen hundert Bakterien reicht aus, um über eine Darmbesiedlung eine Campylobacteriose auszulösen.
Zeigen Tiere Krankheitssymptome, wenn sie infiziert sind bzw. den Erreger in sich tragen?
Stefan Bereswill: Bei Tieren finden sich nur in seltenen Fällen Symptome, da die durch die Bakterien ausgelösten Entzündungsreaktionen über die Produktion anti-inflammatorischer Zytokine in kurzen Zeiträumen kompensiert werden.
Ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich?
Stefan Bereswill: Solche direkten Übertragungen sind wegen der geringen krankheitsauslösenden Infektionsdosis insbesondere bei Kindern von besonderer Bedeutung. Dieser Transmissionsweg ist auch bei Erwachsenen durch fäkal-orale Übertragungswege möglich. Es gibt aber nicht genügend wissenschaftliche Daten, um die Bedeutung dieses Übertragungswegs im Rahmen des gesamten Infektionsgeschehens abschließend bewerten zu können.
Wie genau reagiert das Immunsystem auf den bakteriellen Eindringling?
Stefan Bereswill: Die Symptome einer intestinalen Campylobacteriose beim Menschen mit Bauchschmerzen, Durchfall - auch mit Blutbeimengungen - und Fieber zeigen, dass der klinische Verlauf der Enteritis mit bis zu einer Woche für die Betroffenen schwerwiegend - aber meist selbstlimitierend ist. Aufgrund der Tatsache, dass die Campylobacter-Bakterien kein Exotoxin produzieren, das die Symptomatik ursächlich auslöst, kommt der Aktivierung des angeborenen Immunsystems in Form von Granulozyten und Makrophagen durch bakterielle Polysaccharidstrukturen (Endotoxine) - wie z. B. das Lipo-Oligosaccharid - bei der Pathogenese eine grundlegende Bedeutung zu. Das hat zur Folge, dass neue Therapien auf die Kombination von immunmodulierenden und antibakteriellen Wirkstoffen abzielen. Auch in der Impfstoffentwicklung spielen konservierte Polysaccharidstrukturen der Campylobacter-Bakterien eine besondere Rolle, da die Impfung mit Proteinen durch die außergewöhnlich große genetische Variabilität der Campylobacter-Populationen erschwert wird.
Kann es zu Spätfolgen nach der Erkrankung kommen?
Stefan Bereswill: Einige Infizierte entwickeln schwere postinfektiöse Autoimmunerkrankungen, die das Nervensystem, die Gelenke und den Darmtrakt betreffen. Zu den Komplikationen der Campylobacteriose zählen das Guillain-Barré-Syndrom, die reaktive Arthritis und chronische entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulzerosa sowie das Reizdarmsyndrom, die durch eine initiale Campylobacter-Infektion ausgelöst werden können. Auch kommt es bei immungeschwächten Patienten durch systemische Ausbreitung der Krankheitserreger zu Erkrankungen des Kreislaufsystems und zu Septikämien, die im Einzelfall lebensbedrohlich sein können.
Sind Darmerkrankungen, die sich Reisende zuziehen, oft auf eine Campylobacter-Infektion zurückzuführen?
Stefan Bereswill: Weltweit erhobene Daten belegen eine Bedeutung von Reisen bei der Verbreitung der Campylobacter-Infektion. Dabei spielen Reisen in Regionen, in denen die oben genannten Standards bzgl. Lebensmittel – und Wasserhygiene nicht gegeben, sind eine besondere Rolle.
Kann eine Gabe von Antibiotika gegen das Bakterium auch langfristig negative Folgen für das Mikrobiom haben?
Stefan Bereswill: Die Antibiotikatherapie mit Fluorochinolon-Antibiotika und Makroliden ist möglich, wird aber durch mehrere Faktoren erschwert. Zum einen ist der Einsatz dieser Antibiotika bei Durchfallerkrankungen aus pharmakologischen Gründen in vielen Gesundheitssystemen kontraindiziert, und zum anderen sind große Teile der Campylobacter-Populationen weltweit inzwischen resistent gegen diese Chemotherapeutika, die zum Teil auch in der Tierproduktion eingesetzt wurden bzw. regional noch werden.
Gibt es bestimmte Regionen, in denen das Auftreten von Campylobacter-Bakterien gehäuft vorkommt (Beispiel: In der Nähe von Mastanlagen)?
Thomas Alter: Die Bedeutung des Austrags von Campylobacter aus Tierbeständen wird in mehreren Teilprojekten des Forschungskonsortiums PAC-Campylobacter schwerpunktmäßig untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, dass Campylobacter-Bakterien über verschiedene Wege in die Umwelt gelangen können. Allerdings sind die Krankheitserreger sehr empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen, wie z.B. Sauerstoff, Austrocknung oder UV-Strahlung. Hier fehlen aktuell noch wissenschaftliche Daten, die zeigen werden, ob ein Überleben von Campylobacter-Bakterien in der Umwelt und über einen relevanten Zeitraum hinaus von praktischer Bedeutung ist.
Das Gespräch führte Christoph Kohlhöfer