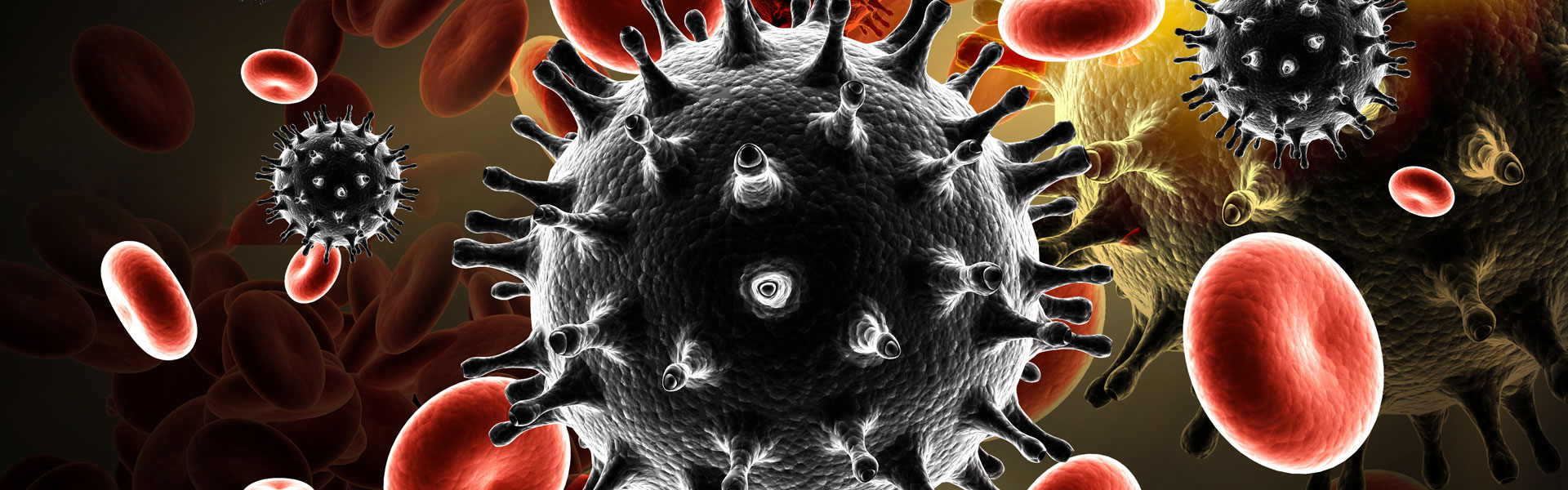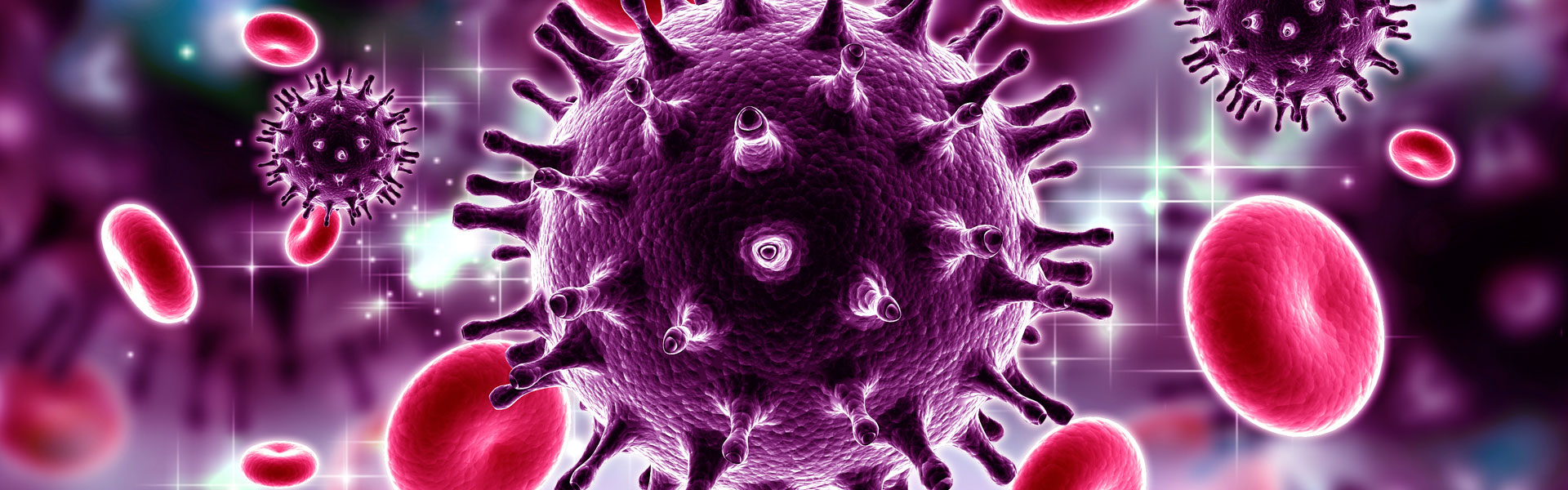Forscher*innen in Deutschland sind angehalten sich in ihrer Arbeit an die Regeln „guter wissenschaftlicher Praxis“ zu halten. Sie sind ein wichtiges Qualitätssicherungswerkzeug, das zudem die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler*innen gewährleisten soll und gemeinsame Verhaltensregeln definiert. In Deutschland fungiert das von der DFG eingesetzte Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft“ als zentrale Beratungsstelle für alle in Deutschland forschenden Wissenschaftler*innen bei Fragen und Konflikten zu guter wissenschaftlicher Praxis. Frau Dr. Czesnick leitet die Geschäftsstelle des Gremiums. Ihr haben wir einige Fragen zur Arbeit des Gremiums und zu guter wissenschaftlicher Praxis im Angesicht der Coronavirus-Pandemie gestellt.
Frau Dr. Czesnick, was genau ist die Aufgabe des Ombudsman für die Wissenschaft?
Czesnick: Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingesetzte Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft“ berät vertraulich bei Fragen zur guten wissenschaftlicher Praxis (GWP). Bei Konflikten, die sich auf mögliches wissenschaftliches Fehlverhalten beziehen, hat das Gremium eine neutrale Rolle und versucht (in Ombudsverfahren) zu vermitteln. Das geht aber nur, wenn das mögliche Fehlverhalten noch korrigierbar ist, wie z.B. bei Autorschafts- oder Datennutzungskonflikten. Bei einem Verdacht auf Plagiate oder Datenfälschung kann hingegen nicht vermittelt werden – derartige Hinweise leitet das Gremium nach einer Vorprüfung an die zuständige Stelle der betroffenen Hochschule oder außerhochschulischen Forschungseinrichtung weiter, etwa die Kommission zur Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens der jeweiligen Einrichtung.
Wie setzt sich das Gremium zusammen?
Czesnick: Das Ombudsgremium besteht aus vier erfahrenen Professorinnen und Professoren, die unterschiedlichen Fachgebieten angehören. Das ist wichtig, da der „Ombudsman für die Wissenschaft“ Wissenschaftler*innen aller Disziplinen berät. Derzeit sind die Gremiumsmitglieder Prof. Dr. Joachim Heberle (Freie Universität Berlin, Physik), Prof. Dr. Daniela Männel (Universität Regensburg, Bio-Medizin), Prof. Dr. Renate Scheibe (Universität Osnabrück, Biologie) und Prof. Dr. Stephan Rixen (Universität Bayreuth, Rechtswissenschaft), der auch Sprecher des Gremiums ist. Unterstützt wird das ehrenamtlich tätige Gremium von einer Geschäftsstelle in Berlin. Auch die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle führen Beratungsgespräche durch.
Im Zentrum Ihrer Arbeit steht die Wahrung der „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG. Was sind wichtige Punkte „guter wissenschaftlicher Praxis“?
Czesnick: Bei guter wissenschaftlicher Praxis geht es in erster Linie um Ehrlichkeit, Fairness und Transparenz in der gemeinsamen Zusammenarbeit in der Wissenschaft. Dies bezieht sich zum Beispiel darauf, dass eine wissenschaftliche Leistung immer den Personen zugeschrieben werden sollte, die sie erbracht haben (wenn es um die Festlegung von Autorschaften oder den „Credit“ für Ideen geht; man denke auch an korrektes Zitieren). Es sollten diejenigen mit Daten arbeiten dürfen, die sie erhoben haben – Wissenschaftler*innen dürfen die Publikation der Daten aber auch nicht aus Eigennutz blockieren, denn das wäre der Wissenschaftsgemeinde und der Öffentlichkeit gegenüber nicht fair. Es geht häufig um eine Balance der Interessen. Wissenschaftler*innen sollten gerade zu Beginn ihrer Karriere von erfahreneren Kolleg*innen auch in Hinsicht auf wissenschaftliche Integrität gut ausgebildet und unterstützt werden; sie sollten dabei lernen, ihre eigene Leistung, aber auch die Leistung anderer einzuschätzen und zu bewerten. Die faire Zusammenarbeit bezieht sich auch auf Kooperationen zwischen Einrichtungen. Das alles sind Aspekte guter wissenschaftlicher Praxis. In der Arbeit mit Konflikten in der Wissenschaft gilt wie sonst auch, dass jede Geschichte (mindestens) zwei Seiten hat. In der Ombudsarbeit ist es daher sehr wichtig, immer alle Beteiligten anzuhören und Belege für Aussagen zu fordern.
Deutschland steht in der Forschung natürlich nicht alleine dar. Wie sieht es mit der Internationalisierung von Qualitätsstandards in der Wissenschaft aus? Gibt es hier allgemein anerkannte Regeln?
Czesnick: Es gibt internationale Guidelines zur wissenschaftlichen Integrität, auf die sich die Wissenschaftsgemeinde – auf unterschiedlichen Ebenen – verständigt hat. Es gibt z.B. den European Code of Conduct for Research Integrity (herausgegeben von ALLEA, 2017), der für viele nationale Leitlinien als Grundlage dient. Internationale Leitlinien werden auch regelmäßig im Rahmen der World Conferences on Research Integrity entwickelt, wie das Singapur Statement (2010), das Montreal Statement (2013) oder die Hong Kong Principles (2019). Auch Publisher und internationale Vereine, wie das „Committee on Publication Ethics“ (COPE) haben anerkannte Leitlinien, z.B. zum Thema Autorschaft, publiziert.
Zahlreiche Länder habe nationale Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis verfasst, die die Gegebenheiten der Wissenschaftslandschaft des jeweiligen Landes berücksichtigen. Dass die Strukturen zur wissenschaftlichen Integrität, wie die Zuständigkeiten nationaler und lokaler „Research Integrity Offices“, von Land zu Land variieren, zeigt sich etwa im europäischen Vergleich bei den Mitgliedern des Netzwerk ENRIO (das European Network of Research Integrity Offices, www.enrio.eu). Der „Ombudsman für die Wissenschaft“ ist seit 2010 aktives ENRIO-Mitglied ist und hat seit 2019 den Vizevorsitz inne. Der Austausch dort gibt uns oft Impulse für die Lösung von Konfliktfällen.
„Publish or perish!“, mit dieser Aussage wird jede Person in der Wissenschaft spätestens in der Promotionszeit konfrontiert. Steht dieser Druck zu Publizieren manchmal der „guten wissenschaftlichen Praxis“ im Weg?
Czesnick: Der immense Publikationsdruck fördert zweifelsohne das Konkurrenzdenken. Das kann in der Wissenschaft (wie in anderen Lebensbereichen auch) ggf. die Leistungsfähigkeit ankurbeln, es treibt aber auch sehr viele negative Blüten. Wir sehen z.B. verstärkt regelrechte „Kämpfe“ um gewisse Positionen in der Autorenreihung, wie Erst- und Letztautorschaften, da diese von Gutachtenden, Arbeitgeber*innen in der Wissenschaft, aber auch von Forschungsfördereinrichtungen häufig noch immer als zentrales Leistungskriterium herangezogen werden. Noch immer hören Doktorand*innen oder Postdocs das Argument, es wäre „für das Institut besser“ wenn die Instituts- oder Gruppenleitung trotz eines minimalen Beitrags an prominenter Stelle auf einem Artikel steht – dabei geht es klar um Metriken und Reputation. Es geht aber auch anders: Es gibt sehr viele integre Wissenschaftler*innen, die sich für den Nachwuchs einsetzen, und die sich (und anderen) ggf. Fehler eingestehen und diese umgehend korrigieren. Auch das sehen wir in der Ombudsarbeit. Es zeigt sich wieder, wie wichtig das Teaching wissenschaftlicher Integrität auf allen Karrierestufen ist.
In Zeiten der Coronaviruspandemie befindet sich die Forschung gewissermaßen unter der Lupe. Dabei treten auch einige Schwachstellen im System zutage. Viele Kontrollprozesse der Wissenschaft beruhen auf Begutachtungen durch Fachkolleg*innen und benötigen einige Zeit. Wie sehr leidet der Begutachtungsprozess ihrer Meinung nach unter der aktuellen Situation, in der Gesellschaft und Politik schnell Ergebnisse wollen und die Forschung an Coronaviren immens gesteigert wurde? Sehen Sie „gute wissenschaftliche Praxis“ durch die starke Beschleunigung der Forschung und des Publizierens im Angesicht der Pandemie in Gefahr?
Czesnick: Die Regeln wissenschaftlicher Integrität sollten selbstverständlich auch in Krisenzeiten beachtet werden – das ENRIO-Netzwerk hat schon im April 2020 in einem Statement auf europäischer Ebene zur Wahrung der „Research Integrity“ während der Pandemie aufgerufen. Auch die DFG hat auf die Bedeutung wissenschaftlicher Qualitätsstandards gerade in der Pandemie hingewiesen. Das heißt, es sollte weiterhin eine kritische und ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen Daten und Ergebnissen wie auch mit den Ergebnissen und Schlussfolgerungen von Kolleg*innen in der Wissenschaft erfolgen. Derartige kritische Diskurse haben wir in den letzten Monaten genauso beobachten können, wie – leider auch – das Zurückziehen von Beiträgen, bei denen Fachkolleg*innen Ungereimtheiten aufgefallen waren. Ob z.B. aufgrund von besonderer Eile (und wie Sie schon feststellten: der Forderung der Gesellschaft nach schnellen Ergebnissen und Lösungen) gewisse Faktoren übersehen wurden, lässt sich im Nachhinein selten klar feststellen. Wir vermuten, dass der dringende Bedarf an zügigen Forschungsergebnissen auch zu Versehen bzw. Fehlern geführt hat, die dann aber durch die Fachgemeinde umgehend aufgedeckt wurden. Auch in der Pandemie greifen die bereits etablierten Selbstkorrekturmechanismen der Wissenschaft. Die Fach-Community erkennt Schwächen und Fehler von Forschungsansätzen während des Peer Reviews, aber auch nach der Publikation von Ergebnissen – unabhängig davon, ob es sich bei Publikationen um Preprints oder Postprints handelt.
Wie schätzen Sie die Folgen der Pandemie auf die Wissenschaft ein? Wird man langfristig Prozesse optimieren müssen?
Czesnick: Die Pandemie wird sicherlich viele Folgen nach sich ziehen – welche genau das sein werden, lässt sich jetzt noch nicht abschließend einschätzen. Wie wichtig und hilfreich es sein kann, wenn Forschende Fähigkeiten im Bereich der Wissenschaftskommunikation besitzen, hat sich während der Pandemie ganz besonders gezeigt. Digitale Kommunikationswege als Alternative zu Sitzungen und Dienstreisen sollten auch künftig verstärkt genutzt werden. Sie sparen Zeit, die dann für die Forschung verwendet werden kann, außerdem verbessert es die Vereinbarkeit von Privat- bzw. Familienleben und Beruf. Die problematischen Aspekte des Wissenschaftssystems bestehen unabhängig von Pandemien. Sie werden seit Jahren debattiert, z.B. im Rahmen von Konferenzen zur wissenschaftlichen Integrität oder auf den Symposien für Ombudspersonen, die wir regelmäßig organisieren. In diesem Jahr ging es z.B. um Machtmissbrauch und Abhängigkeiten im Wissenschaftssystem. In der Konfliktberatung erreichen uns (trotz Pandemie) weiterhin meist „klassische“ Fragen zu Plagiaten, Forschungsdaten oder Autorschaften. Aktuell erreichen uns etwas mehr Autorschaftskonflikte als sonst – möglicherweise, weil viele Wissenschaftler*innen die Zeit im Home Office in die Fertigstellung von Manuskripten investieren. Ansonsten macht sich die Pandemie auf unserer Ebene der Ombudsarbeit bislang eher wenig bemerkbar. Da Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen derzeit pandemiebedingt viele neue Herausforderungen stemmen müssen (wie der Organisation der digitalen Lehre), sind die Prozesse im Wissenschaftsbetrieb momentan vielleicht etwas verlangsamt. Wir sehen aber mit Sicherheit keinen Stillstand, die Fragen der guten wissenschaftlichen Praxis bleiben unverändert wichtig.
Vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen!
Interview: Dr. Dana A. Thal für die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen